Zwei Perspektiven – eine Mission
news
Dritte Mission
Zwei Perspektiven – eine Mission
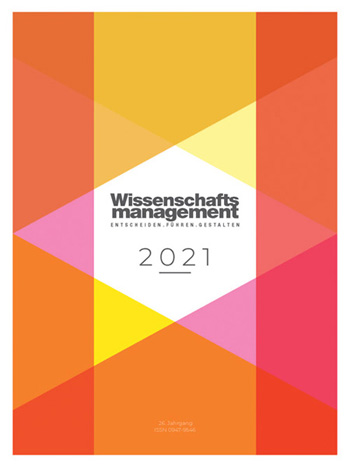
Der vorliegende Artikel widmet sich dieser Forschungsfrage anhand des Vergleichs einer Technischen Universität und einer Pädagogischen Hochschule. Dieser verweist mit Bezug auf ihre Transferstrategien auf eine gemeinsame Orientierung an Innovation, macht aber zugleich darauf aufmerksam, dass Transferleitbilder einerseits unternehmerisch, andererseits durch das Diktum lebenslangen Lernens geprägt sind.
Entwicklung einer dritten Mission
Noch in den 1950er- und 1960er-Jahren war ein Kontraktmodell zwischen Wissenschaft und Gesellschaft leitend, wonach die Wissenschaft gesellschaftlich relevantes Wissen erzeugen sollte, aber nicht mit Nutzenerwartungen belastet wurde.
Die Verschlechterung finanzieller Rahmenbedingungen führte zu mehr Rechtfertigungsdruck für Wissenschaftsausgaben und zu einer Orientierung von Hochschulen an ökonomisch verwertbarem Wissen, um zum volkswirtschaftlichen Wachstum beizutragen oder auch zur Qualifizierung breiter Bevölkerungsschichten (Kloke/Krücken 2010, 33).
Die sogenannte dritte Mission des Transfers – neben erster (Lehre) und zweiter Mission (Forschung) – hat seither viel Aufmerksamkeit erfahren. Universitäten und andere Bildungseinrichtungen sind vermehrt aufgerufen, die Ergebnisse ihrer ersten und zweiten Mission zu nutzen, um zur Lösung der wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen beizutragen, vor denen die (lokale) Gemeinschaft steht (Pinheiro et al. 2015; Schober et al. 2016).
Diese Aktivitäten beinhalten die Zusammenarbeit „zwischen Hochschuleinrichtungen und ihren größeren Gemeinschaften (lokal, regional/staatlich, national, global) für den gegenseitig vorteilhaften Austausch von Wissen und Ressourcen“ (Driscoll 2008, 39) und somit die aktive Übernahme von Verantwortung (Europäische Kommission 2011) in der regionalen und nationalen Entwicklung (Havas et al. 2010).
Die Gesellschaft rückt in den Fokus
Zunächst stand dabei der Transfer von Wissen zwischen Hochschule und Industrie im Fokus, die Kommerzialisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse so wie die Stärkung von Beziehungen und Kooperationen zwischen akademischen und unternehmerischen Akteuren. Um diesen Technologietransfer geht es seit einigen Jahren nicht mehr allein.
Transfer bezieht in einem breiteren Sinne Interaktionen wissenschaftlicher Akteure mit Partnern außerhalb der Wissenschaft, aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Politik mit ein und wird unter dem Diskurs „Transfer in die Gesellschaft“ (Wissenschaftsrat 2016, 5) verhandelt. Hochschulen kommt hierbei als Bildungs- und Forschungseinrichtungen die Verantwortung zu, die (Weiter)Entwicklung von Kompetenzen zu unterstützen und innovativ auszubauen.
In diesem Rahmen wird oft darauf verwiesen, dass sich Hochschulen zunehmend als gesellschaftliche Akteure begreifen, die Bedürfnisse externer Anspruchsgruppen aufgreifen und gemeinschaftlich mit diesen bearbeiten (Jason/ Glenwick 2016). Die Schnittstelle von Grundlagenforschung, Innovation und gesellschaftlichem Engagement gewinnt dabei an Bedeutung für Hochschulen (de La Torre/Pérez-Esparrells/Casani 2018).
Basierend auf diesen Entwicklungen stellen die Autoren die Frage, inwiefern sich verschiedene Hochschultypen im Umgang mit der dritten Mission unterscheiden. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? Welche Diskurse dominieren die jeweilige Mission und wie wird angesichts der aktuellen Pandemie-Situation Transfer unter digitalen Bedingungen gedacht und gelebt?
....
Fazit
Insgesamt zeigt der Vergleich individuelle Entwicklungspfade von Hochschulen mit diversen Profilen vor dem Hintergrund der Third Mission als einem allgemeinen Entwicklungstrend in der deutschen Hochschullandschaft. Dabei nehmen die Hochschulen als Produzierende und Verarbeitende von Wissen in der sich entwickelnden Wissensgesellschaft eine zentrale Position ein.
-
Der komplette Beitrag ist im ► Onlineshop von Lemmens Medien erhältlich. Den Abonnenten der Zeitschrift Wissenschaftsmanagement steht der Beitrag in ihrem Account zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Dr. phil. Anika Noack ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.
Dr. Martin Rehm ist Transfermanager am Institut für Bildungsconsulting und Projektmanager im Kompetenzzentrum Medien an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.






















